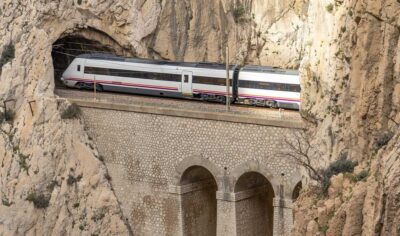Die Köhlbrandbrücke gehört zu den bekanntesten Ingenieurbauten Deutschlands – und zu den problematischsten. Sie verbindet seit 1974 zentrale Teile des Hamburger Hafens. Doch das Bauwerk ist nicht nur technisch in die Jahre gekommen, sondern auch ein Symbol für die Herausforderungen der deutschen Infrastrukturpolitik: Verzögerungen, Planungswirrwarr, hohe Kosten. Ein Ersatz ist längst beschlossen – doch er kommt spät. Sehr spät.

Das erwartet Sie in diesem Beitrag
- Die Geschichte eines Hafentores
- Frühe Mängel, erste Schäden
- Ein Jahrhundert sollte sie halten – nach 50 Jahren ist Schluss
- Überlastet: Verkehrszahlen steigen
- Tunnel oder Brücke? Eine jahrelange Debatte
- Entscheidung 2024: Neubau der Brücke kommt
- Deutschlandtempo? Fehlanzeige
- Infrastruktur unter Druck
- Mehr als ein lokales Problem
- Ein Jahrhundertprojekt mit Verspätung
Die Geschichte eines Hafentores
Am 8. Mai 1970 starteten die Bauarbeiten für die Köhlbrandbrücke. Bereits vier Jahre später war das markante Bauwerk fertiggestellt. Die Einweihung fand am 20. September 1974 unter großem öffentlichen Interesse statt. Drei Tage lang durften Hamburgerinnen und Hamburger die Brücke zu Fuß überqueren, bevor der Autoverkehr freigegeben wurde. 600.000 Menschen kamen – mehr als erwartet.
Die Schrägseilbrücke mit einer Gesamtlänge von 3618 Metern überspannt den Köhlbrand, einen Seitenarm der Elbe. Sie verbindet Steinwerder mit Waltershof – zwei wichtige Hafenareale. Die Fahrbahn liegt auf 55 Metern Höhe, getragen von 88 Stahlseilen, die an zwei 135 Meter hohen Pylonen befestigt sind. Optisch erinnert sie viele an die Golden Gate Bridge in San Francisco. Schon 1975 wurde sie mit dem Europäischen Stahlbaupreis ausgezeichnet – als „schönste Brücke des Kontinents“.
Frühe Mängel, erste Schäden
Die Euphorie währte nicht lange. Bereits 1978 mussten die ersten Stahlseile ausgetauscht werden. Rost hatte sie geschwächt. Dennoch blieb die Brücke ein Symbol des Aufschwungs – und eine tragende Säule der Hamburger Logistik. Auf vier Spuren rollte jahrzehntelang der Schwerlastverkehr zwischen den Hafen-Terminals und der Autobahn.
1998 kam es zu einem Unfall, als ein niederländischer Schwimmkran den Brückenkasten beschädigte. Die Reparatur dauerte Wochen, der Verkehr staute sich kilometerweit. Spätestens seitdem galt das Bauwerk als kritisch.
Ein Jahrhundert sollte sie halten – nach 50 Jahren ist Schluss
Ursprünglich rechnete man mit einer Lebensdauer von 100 Jahren. Doch eine Studie der TU Hamburg-Harburg aus dem Jahr 2008 legte nahe: Nur noch bis etwa 2030 lohnen sich Instandhaltungsmaßnahmen wirtschaftlich. Danach wäre ein Neubau günstiger – selbst wenn die Brücke technisch noch intakt bliebe.
Ein wachsendes Problem ist der Betonkrebs: eine chemische Reaktion zwischen Zementbestandteilen und im Gestein enthaltenem Silizium. Dabei entstehen Risse, die durch eindringendes Wasser weitere Schäden verursachen. Besonders betroffen sind die Auffahrten. Hinzu kommt Chloridbelastung durch Streusalz.
Überlastet: Verkehrszahlen steigen
Tag für Tag überqueren rund 34.000 Fahrzeuge die Brücke, darunter etwa 13.000 Lkw (Stand 2024). Und diese Lkw sind heute größer und schwerer als zur Bauzeit angenommen. Die Konsequenz: Seit 2012 gilt ein Überholverbot für Lkw. Seit 2019 müssen Lkw zudem einen Mindestabstand von 50 Metern einhalten. Markierungen auf der Fahrbahn sollen das Einhalten erleichtern.
Die Belastung ist enorm. Kaum eine andere Straße in Norddeutschland bewältigt so viel Schwerlastverkehr.
Tunnel oder Brücke? Eine jahrelange Debatte
Bereits 2012 kündigte der damalige Bürgermeister Olaf Scholz den Abriss der alten und den Bau einer neuen Querung an. Doch schnell wurde die Idee eines Tunnels ins Spiel gebracht. Er würde mehr kosten – damals rund 3 Milliarden Euro –, hätte aber auch Vorteile: keine Witterungseinflüsse, längere Lebensdauer, zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten unter der Fahrbahn.
Im Jahr 2021 sah es ganz so aus, als würde der Tunnel tatsächlich kommen. Doch die Kostenprognosen stiegen auf 5 Milliarden Euro. Hinzu kam: Der Untergrund erwies sich als problematisch – zu matschig für ein sicheres Vorhaben in dieser Dimension.
Entscheidung 2024: Neubau der Brücke kommt
Nach Jahren der Diskussion fasste der Hamburger Senat im April 2024 eine Entscheidung: Die alte Brücke wird ersetzt – durch eine neue Brücke. Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard erklärte: „Nach Abwägung aller unterschiedlichen Querungsalternativen überwiegen die Vorteile einer Brücke.“
Bis zum Schluss hat der Denkmalverein darum gekämpft, dass die denkmalgeschützte Brücke erhalten bleibt und nur für den Schwerlastverkehr gesperrt wird. Der Verein möchte weiterhin dafür kämpfen, doch momentan sieht es ganz stark nach einem Neubau aus.
Der Neubau soll 5,3 Milliarden Euro kosten und eine Durchfahrtshöhe von über 70 Metern bieten. So können auch die größten Containerschiffe Hamburgs moderne Terminals erreichen. Baubeginn ist für 2033 geplant. Die Verkehrsfreigabe ist für 2042 vorgesehen – exakt 18 Jahre nach der endgültigen Entscheidung.
Deutschlandtempo? Fehlanzeige
Der Fall Köhlbrandbrücke steht exemplarisch für die langsamen Planungsprozesse in Deutschland. Während die alte Brücke in nur sechs Jahren entstand, sind für den Ersatzbau nun neun Jahre Planung und neun Jahre Bauzeit vorgesehen. Das kritisieren insbesondere die Hafenwirtschaft und Logistikunternehmen.
„Wenn wir 2040 fertig sind, freuen wir uns alle, und wenn es 2039 so weit ist, noch mehr“, sagte Leonhard dem Hamburger Abendblatt. Doch bis dahin bleibt die alte Brücke – mit aufwendiger Überwachung durch 520 Sensoren – ein Risikofaktor.
Infrastruktur unter Druck
Die Brückenproblematik ist kein Einzelfall. Deutschlandweit gelten rund 16.000 der etwa 130.000 Brücken als sanierungsbedürftig. Allein der Bund investiert jährlich rund 2,5 Milliarden Euro in deren Instandhaltung. Die meisten stammen aus der Nachkriegszeit, viele wurden für deutlich geringere Lasten geplant.
Brücken wie die in Leverkusen oder der Rahmedetalbrücke in NRW zeigen, wie kritisch der Zustand vieler Querungen ist. Auch dort führen Sperrungen zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden.
Mehr als ein lokales Problem
Der Fall Köhlbrandbrücke ist mehr als ein lokales Problem. Er zeigt, wie schwer sich Deutschland mit dem Erhalt und dem Ersatz zentraler Infrastrukturen tut. Fachkräftemangel im Bauwesen, langwierige Genehmigungsprozesse, Streit über Varianten und Finanzierung – all das verzögert dringend nötige Projekte.
Professor Torsten Leutbecher von der Universität Siegen betont: „Wenn im Hafen der Schiffsverkehr nicht blockiert werden darf, sind die Planung, die eingesetzten Bauverfahren und die Ausführung wesentlich komplexer, als wenn ich auf der grünen Wiese baue.“ Zudem erschwere der Rückgang von Fachkräften im Ingenieurbereich die Umsetzung großer Bauprojekte.
Ein Jahrhundertprojekt mit Verspätung
Trotz aller Kritik wird die neue Brücke wohl kommen. Der Bau soll im Stil der alten erfolgen – mit hohen Pylonen und markanter Silhouette. Die Stadt will ein neues Wahrzeichen schaffen – „eine Ikone der Ingenieurbaukunst“, wie Leonhard sagt. Die Lebensdauer ist erneut auf 100 Jahre angesetzt.
Doch ob die alte Brücke wirklich bis 2042 durchhält, ist offen. Immer wieder muss die Brücke wegen Reparaturen gesperrt werden. Die jährlichen Instandhaltungskosten steigen – auf voraussichtlich 10,7 Millionen Euro im Jahr 2029. Und jeder Schaden, jeder neue Riss erhöht das Risiko, dass Hamburgs wichtigste Hafentransportachse früher gesperrt werden muss.