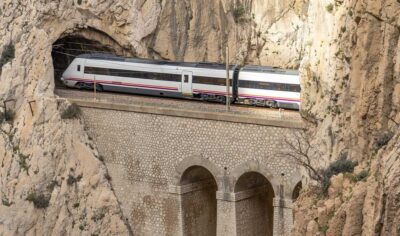Jahr für Jahr endet für Tausende Photovoltaik-Anlagen in Deutschland die Einspeisevergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Das betrifft alle Anlagen, die vor über 20 Jahren in Betrieb genommen wurden. Was viele nicht wissen: Diese sogenannten Ü20-Anlagen liefern oft noch zuverlässig Strom – doch wie geht es ohne feste Förderung weiter?

Das erwartet Sie in diesem Beitrag
- Der Status quo nach 20 Jahren
- Rechenbeispiel: Volleinspeisung mit Marktvergütung
- Eigenverbrauch als Alternative
- Wirtschaftlichkeit hängt vom Verbrauch ab
- Zusätzliche Nutzungen für Solarstrom
- Technik-Check: Pflicht für Weiterbetrieb
- Repowering: Neue PV-Anlage auf altem Dach
- Was tun mit den alten Modulen?
- Weitere Option: Nulleinspeisung
- Eintragungspflichten im Marktstammdatenregister
- Fazit: Ü20 heißt nicht am Ende
Der Status quo nach 20 Jahren
Wenn Ihre PV-Anlage im Jahr 2005 installiert wurde, endet Ihre Förderung am 31. Dezember 2025. Ab dem 21. Betriebsjahr entfällt die feste EEG-Vergütung. Stattdessen erhalten Sie nur noch den sogenannten „Jahresmarktwert Solar“ – eine Vergütung, die sich am Strombörsenpreis orientiert. Für 2023 lag dieser bei 7,2 Cent/kWh. Davon werden Vermarktungskosten abgezogen – 1,8 Cent für 2024, 0,72 Cent für 2025. Ein intelligentes Messsystem halbiert diese Pauschale.
Was bleibt: Die Möglichkeit, den erzeugten Strom weiterhin ins Netz einzuspeisen. Laut EEG 2023 darf der Netzbetreiber den Strom nicht verweigern. Viele Altanlagen speisen ohnehin vollständig ein – das kann so bleiben. Doch lohnt sich das?
Rechenbeispiel: Volleinspeisung mit Marktvergütung
Eine Anlage mit 2 kWp und einem Jahresertrag von 1.700 kWh erhält bei geschätzten 4 Cent pro kWh rund 68 € Vergütung im Jahr.
| Posten | Wert |
| Anschlussvergütung | 68 € |
| Betriebskosten | 100 € |
| Anteil Anlagencheck (300 € über 10 Jahre) | 30 € |
| Summe Ausgaben | 130 € |
| Jährliches Defizit | -62 € |
Ein wirtschaftlicher Gewinn ist bei der Volleinspeisung selten. Dafür ist der Aufwand gering.
Eigenverbrauch als Alternative
Eigenverbrauch wird finanziell attraktiver, je höher Ihre Stromkosten sind. Jede selbstgenutzte kWh spart Netzstrom ein – aktuell rund 33 Cent je kWh. Der überschüssige Strom kann weiterhin ins Netz eingespeist werden, Sie erhalten dafür die Marktvergütung.
Beispielrechnung: 2 kWp Anlage mit Eigenverbrauch
- Erzeugung: 1.700 kWh
- Eigenverbrauchsanteil: 40 % → 680 kWh
- Ersparnis: 680 kWh × 0,33 €/kWh = 224 €
- Einspeisevergütung (1.020 kWh × 0,04 €): 41 €
| Posten | Wert |
| Summe Einnahmen | 265 € |
| Betriebskosten | 100 € |
| Anteil Anlagencheck | 30 € |
| Anteil Umrüstungskosten | 20 € |
| Summe Ausgaben | 150 € |
| Überschuss | 115 € |
Die Umstellung kostet einmalig etwa 200 €. Über zehn Jahre gerechnet ergibt sich ein klarer Vorteil.
Beispielrechnung: 5 kWp Anlage mit Eigenverbrauch
- Erzeugung: 4.250 kWh
- Eigenverbrauch: 850 kWh (20 %)
- Ersparnis: 280 €
- Einspeisevergütung: 3.400 kWh × 0,04 € = 135 €
- Einnahmen gesamt: 415 €
Kosten (analog zu obigem Beispiel): 150 €.
Überschuss: 265 € pro Jahr.
Je größer die Anlage, desto besser fällt die Bilanz aus.
Wirtschaftlichkeit hängt vom Verbrauch ab
Ob sich der Eigenverbrauch Ihres selbst erzeugten Solarstroms wirtschaftlich rechnet, hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab: Ihrem individuellen Stromverbrauchsprofil und der Höhe des Netzstrompreises, den Sie dadurch einsparen.
Grundsätzlich gilt: Je mehr Strom Sie tagsüber selbst verbrauchen – also genau dann, wenn Ihre Photovoltaikanlage Solarstrom produziert – desto höher fällt Ihr finanzieller Vorteil aus. Denn jede Kilowattstunde, die Sie nicht vom Energieversorger beziehen müssen, spart bares Geld. Bei aktuellen Strompreisen von rund 33 Cent pro kWh ist das Einsparpotenzial nicht unerheblich.
Haushalte mit hohem Stromverbrauch untertags profitieren besonders. Dazu zählen zum Beispiel:
- Familien mit Kindern, bei denen tagsüber gekocht, gewaschen oder Hausaufgaben am Laptop gemacht werden
- Haushalte mit Homeoffice-Arbeitsplätzen
- Personen mit elektrischer Warmwasserbereitung, etwa über einen Durchlauferhitzer oder Heizstab
- Nutzer:innen einer Wärmepumpe, die tagsüber heizt oder Warmwasser bereitet
- Besitzer:innen eines Elektroautos, das regelmäßig zu Hause geladen wird
Je mehr elektrische Geräte gleichzeitig in Betrieb sind, desto höher ist die Chance, einen Großteil des erzeugten Solarstroms direkt selbst zu nutzen. Damit steigt der sogenannte Eigenverbrauchsanteil. Dieser Wert gibt an, wie viel Prozent des erzeugten Stroms Sie selbst verbrauchen und nicht ins Netz einspeisen.
Ein Beispiel: Erzeugt Ihre Ü20-PV-Anlage im Jahr 4.000 kWh Strom und Sie nutzen davon 1.600 kWh direkt im Haushalt, beträgt Ihr Eigenverbrauchsanteil 40 %. Bei einem Netzstrompreis von 0,33 €/kWh ergibt das eine jährliche Einsparung von 528 €.
Zusätzliche Nutzungen für Solarstrom
Wollen Sie mehr Strom selbst nutzen, können Sie:
- Haushaltsgeräte gezielt tagsüber betreiben
- Warmwasser mit PV-Heizstab erzeugen
- Wärmepumpen im Sommer mit Solarstrom betreiben
- Ein Elektroauto laden
- Einen Batteriespeicher installieren
Die letzten beiden Optionen lohnen sich allerdings erst bei höheren Investitionen. Wer lieber klein anfängt, kann bereits durch Verhaltensanpassungen viel bewirken.
Technik-Check: Pflicht für Weiterbetrieb
Nach 20 Jahren sollten Sie Ihre Anlage überprüfen lassen. Funktionieren Module, Wechselrichter und Verkabelung noch einwandfrei? Ein technischer Check kostet etwa 250 bis 300 €.
Das Gutachten zeigt, ob sich ein Weiterbetrieb überhaupt lohnt. Wenn größere Schäden auftreten oder die Leistung stark gesunken ist, sollten Sie über einen Austausch der Anlage nachdenken.
Repowering: Neue PV-Anlage auf altem Dach
Wenn Ihre bestehende Anlage technisch überholt ist, bietet sich ein Repowering an. Neue Module liefern auf gleicher Fläche oft doppelt so viel Strom. Die Einspeisevergütung gilt dann wieder für 20 Jahre.
Aktuelle Vergütungssätze laut EEG 2024:
- Volleinspeisung: 12,73 Cent/kWh
- Eigenverbrauch mit Teileinspeisung: 8,03 Cent/kWh
Auch steuerlich wurde vieles vereinfacht: Erträge aus PV-Anlagen bis 30 kWp sind einkommensteuerfrei. Die Investition lohnt sich besonders, wenn Sie den erzeugten Strom selbst verbrauchen.
Was tun mit den alten Modulen?
Viele Altmodule funktionieren noch – sie müssen nicht entsorgt werden. Sie lassen sich weiterverwenden:
- Inselanlagen im Garten, Wohnmobil oder Ferienhaus
- Ersatzteile für andere Anlagen
- Spenden für Entwicklungsprojekte
Damit leisten Sie weiterhin einen Beitrag zur Energiewende – auch ohne Netzanschluss.
Weitere Option: Nulleinspeisung
Eine weniger bekannte, aber technisch durchaus mögliche Variante des Weiterbetriebs einer Ü20-Photovoltaikanlage ist die sogenannte Nulleinspeisung. In diesem Fall wird der gesamte erzeugte Solarstrom im Haushalt selbst verbraucht – eine Einspeisung ins öffentliche Stromnetz findet nicht mehr statt.
So funktioniert die Nulleinspeisung
Moderne Wechselrichter bieten die Möglichkeit, die maximale Einspeiseleistung auf null zu begrenzen. Die Photovoltaikanlage produziert dann immer nur so viel Strom, wie aktuell im Haushalt verbraucht wird. Sobald der Strombedarf gedeckt ist, regelt die Anlage automatisch ab. Überschüssiger Strom wird nicht gespeichert oder eingespeist, sondern schlicht nicht erzeugt.
Technisch ist diese Lösung relativ einfach umzusetzen – vor allem, wenn die bestehende Elektroinstallation ohnehin auf Eigenverbrauch umgestellt wurde. In vielen Fällen genügt es, die entsprechende Funktion im Wechselrichter zu aktivieren oder über ein Energiemanagementsystem den Verbrauch in Echtzeit abzugleichen.
Die ökonomische Perspektive
Rein wirtschaftlich kann Nulleinspeisung in bestimmten Situationen attraktiv sein. Vor allem dann, wenn die Einspeisevergütung (z. B. der „Marktwert Solar“ abzüglich Kostenpauschale) sehr niedrig liegt, lohnt sich der Verkauf des Stroms an den Netzbetreiber kaum. Gleichzeitig fallen für jede eingespeiste Kilowattstunde zusätzliche Anforderungen an die Messtechnik oder Meldungen an den Netzbetreiber an. Diese können – insbesondere bei kleinen Anlagen – mit unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand verbunden sein.
Durch den vollständigen Eigenverbrauch vermeiden Sie diese Aufwände. Die Rechnung ist dabei einfach: Eine Kilowattstunde Netzstrom kostet Sie rund 33 Cent. Jede selbst genutzte Kilowattstunde spart diesen Betrag – das ist deutlich mehr, als Sie über die Marktvergütung für die Einspeisung erhalten würden. Wenn Sie eine ältere Anlage vollständig abgeschrieben haben, entstehen Ihnen nur noch geringe laufende Kosten. Dann kann es durchaus sinnvoll sein, auf einen wirtschaftlich optimierten Eigenverbrauch zu setzen.
Allerdings gilt: Diese Variante lohnt sich nur dann, wenn Sie tagsüber regelmäßig genug Strom verbrauchen. Denn bei Nulleinspeisung wird Solarstrom nicht gespeichert, sondern bei geringer Nachfrage schlicht nicht produziert.
Die ökologische Kehrseite
So nachvollziehbar dieser Ansatz aus finanzieller Sicht auch sein mag: Aus ökologischer Perspektive ist die Nulleinspeisung problematisch. Denn Ihre Anlage könnte rein technisch deutlich mehr Strom produzieren – Strom, der klimafreundlich ist und fossile Energie im Netz ersetzen könnte. Wird dieser Überschuss nicht genutzt, sondern „abgeregelt“, bedeutet das eine verlorene Erzeugungschance.
Je nach Anlagengröße und Verbrauchsverhalten bleiben so bis zu 70 % des potenziell erzeugbaren Solarstroms ungenutzt. Besonders kritisch ist das in Zeiten, in denen jede Kilowattstunde grünen Stroms zählt – für die Versorgungssicherheit, die Netzstabilität und nicht zuletzt für den Klimaschutz.
Eintragungspflichten im Marktstammdatenregister
Nicht vergessen: Änderungen an der Anlage – z. B. Umstellung auf Eigenverbrauch, Betreiberwechsel oder Stilllegung – müssen im Marktstammdatenregister eingetragen werden. Diese Pflicht gilt auch für ausgeförderte Anlagen.
Fazit: Ü20 heißt nicht am Ende
Photovoltaikanlagen können deutlich länger als 20 Jahre laufen. Auch ohne Förderung kann sich der Weiterbetrieb lohnen – insbesondere mit Eigenverbrauch. Wichtig ist, die Anlage technisch prüfen zu lassen und alle Optionen abzuwägen.
Wer nichts unternimmt, erhält weiterhin eine geringe Vergütung für eingespeisten Strom. Wer aktiv wird, kann bares Geld sparen oder die Anlage modernisieren – und so ein weiteres Kapitel in der Energiewende schreiben.